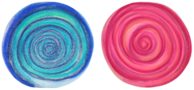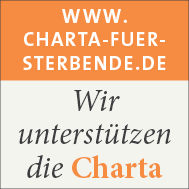Repariere nichts, was nicht kaputt ist.
Steve de Shazer
Einzelberatung für Führungskräfte
Führungskräfte haben einen enormen Einfluss auf die Zufriedenheit, die Leistung und die Gesundheit ihrer Mitarbeiter_innen. Gleichzeitig ergeben sich aus einer Führungsrolle hohe Anforderungen an die „Selbstführung“ und den sorgsamen Umgang mit den eigenen Ressourcen. Vor allem Nachwuchsführungskräfte werden meist nur unzureichend auf die Herausforderungen dieser neuen Rolle vorbereitet. Um als Führungskraft gesund zu bleiben, glaubwürdig zu sein, ernst genommen zu werden, respektiert und wertgeschätzt zu werden, ist der erste Schritt der, sich selbst ernst zu nehmen, seine Kompetenzen zu kennen, sich selbst zu reflektieren und sich mit der Rolle als Führungskraft auseinanderzusetzen und zu identifizieren. Je nach aktuellem Anliegen kann eine Beratung dazu dienen, mehr Klarheit über die eigenen Ziele, Grenzen, Potenziale und Gestaltungsmöglichkeiten zu erhalten; sie kann dabei helfen, etwas darüber zu erfahren, die eigene Motivierung und die der Mitarbeiter_innen wirksam beeinflussen zu können; wenn Stress und Belastungserleben im Vordergrund stehen, können durch gemeinsame Reflexion und Exploration der Ist-Situation, hilfreiche Bewältigungsstrategien oder neue Impulse für die eigene Entwicklung & Veränderung angestoßen werden. Diese Form der Beratung kann im organisationalen Kontext ermöglicht werden oder auch im privaten Rahmen stattfinden.Die Aufgabe wechselt nicht nur von Mensch zu Mensch – entsprechend der Einzigartigkeit jeder Person – sondern auch von Stunde zu Stunde, gemäß der Einmaligkeit jeder Situation.
Viktor Frankl
Beratung für Gruppen – Seminare, Workshops, Fortbildungen
Das Beratungssetting für Gruppen kann sich entweder auf Anliegen eines Teams beziehen, wo Bedarf für Teamentwicklungsmaßnahmen gesehen werden, oder auf einen konkreten Fortbildungswunsch für eine bestimmte Gruppe von Mitarbeiter_innen. Teamentwicklungsmaßnahmen können dann angezeigt und sinnvoll sein, wenn das Teamklima als unbefriedigend wahrgenommen wird, die Zusammenarbeit beeinträchtigt ist, Mobbing beobachtbar ist oder Leistungs- und Motivationsverluste entstanden sind. Im Rahmen eines Team-Workshops besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit der Teamleitung, an den entsprechenden Themen zu arbeiten. Dies kann die neue Ausrichtung auf geteilte Ziele sein, die Klärung der individuellen Rollen und Aufgaben innerhalb des Teams, es können Rahmenbedingungen für eine konstruktive Zusammenarbeit konkretisiert werden oder Faktoren identifiziert werden, die einen positiven Effekt auf gruppendynamische Prozesse und den Teamerfolg haben. Fortbildungen und Seminare zur Erweiterung von Führungskompetenzen (Kommunikation, Moderation, Konfliktlösung, Führen mit Zielen, etc.) orientieren sich am jeweiligen Bedarf und können sich themenorientiert an Führungskräfte aus unterschiedlichen Teams richten. Diese Form der Beratung findet in der Regel im organisationalen Kontext statt. Externe Räumlichkeiten (beispielsweise Tagungs-, oder Seminarräume von Hotels) sind hierfür manchmal vorteilhaft, um mehr Distanz zum Arbeitsalltag herstellen zu können.
Systemische Therapie und Beratung für Einzelpersonen, Paare oder Familien
Das Leben stellt uns manchmal vor Herausforderungen, denen wir uns alleine nicht mehr gewachsen fühlen. Wenn das Ausmaß an Kommunikationsstörungen, Konflikten, privaten oder beruflichen Problemlagen, Belastungen durch neue Lebensabschnitte, Trennungsschmerz, Verlusterfahrungen oder auch chronische Erkrankungen die Sicht auf hilfreiche Bewältigungsmöglichkeiten oder Lösungsstrategien versperrt, kann systemische Therapie oder Beratung neue Perspektiven eröffnen, problemaufrechterhaltende Muster aufdecken, verschüttete Ressourcen aktivieren und damit neue Bewältigungs- und Handlungskompetenzen ermöglichen. Oftmals reichen bereits wenige Sitzungen aus, um neue Wege zu erkennen und gehen zu können. Diese Form der Unterstützung wird auf die aktuelle Problemlage, das relevante Bezugssystem, ihre ganz individuellen Bedürfnisse ausgerichtet und findet in meinem privaten Praxisraum, am Telefon oder per Video-Chat statt.

DIE FÜNF FREIHEITEN von Virginia Satir
Die Freiheit
zu sehen und zu hören
was jetzt ist,
anstatt was sein sollte,
was war oder was sein wird
Die Freiheit
zu fühlen was ich fühle,
anstatt zu fühlen, was man fühlen sollte
Die Freiheit
zu sagen was ich fühle und denke,
anstatt was ich fühlen und denken sollte
Die Freiheit
danach zu fragen was ich gerne möchte,
anstatt auf Erlaubnis zu warten
Die Freiheit
auf eigene Faust Risiken einzugehen,
anstatt immer auf Nummer Sicher
Unabhängig davon, in welcher Situation und Konstellation eine Zusammenarbeit stattfindet, fühle ich mich einem humanistischen Menschenbild verpflichtet, das den Menschen als eine untrennbare Einheit von Körper, Seele und Geist anerkennt. Das menschliche Selbst – bewusst – sein befähigt uns, nicht nur uns selbst zu reflektieren und das eigene Ich zu erkennen, sondern auch unser gegenüber – unsere Mitmenschen – als wertvolle und eigenständige Persönlichkeiten zu respektieren. Humanisten gehen davon aus, dass jeder Mensch nach Selbstaktualisierung, Autonomie und Wachstum strebt und seine Potenziale und Kompetenzen in Ausrichtung auf ein „gutes“ Leben entfalten möchte.
Die humanistische Psychologie wird in Abgrenzung zur Psychoanalyse und dem Behaviorismus als „dritte Kraft in der Psychologie“ bezeichnet (Kriz, 2014). Carl Rogers, Chalotte Bühler, Rollo May, Virginia Satir und Abraham Maslow waren 1962 Gründungsmitglieder der „Gesellschaft für humanistische Psychologie“. Sie bereiteten damals den Weg für die Theoriebildung und Erforschung subjektiven menschlichen Erlebens und Verhaltens, unter der Annahme, dass der Mensch selbstbestimmt und proaktiv handelt und über einen konstruktiven Kern verfügt. Zu den philosophischen Wurzeln dieser Strömung zählen der Existenzialismus (Martin Buber, Sören Kirkegaard, Friedrich Nietzsche, Gabriel Marcel, Paul Tillich), die Phänomenologie (Edmund Husserl, Max Scheler), der klassische und sozialistische Humanismus (Herder, Marx) und der Humanismus moderner französischer Prägung (Sartre, Camus, Merlau-Ponty).
Aus diesem Denken heraus entwickelte Carl Rogers die klientenzentrierte „nichtdirektive Beratung“ (Rogers, 2018). Zu den notwendigen und hinreichenden Bedingungen für eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Klient_innen und Berater_innen gehört unter anderem, dass Berater_in und Klient_in sich in einem professionellen Rahmen als Partner_innen auf Augenhöhe begegnen. Ratsuchende werden als Expert_innen für ihr eigenes Leben betrachtet und erfahren durch die helfende Person verständnisvolle Begleitung bei der Erforschung ihrer Anliegen und Lösungen. Durch eine zugewandte und akzeptierende Haltung werden Klient_innen dazu ermutigt, die eigene Situation oder belastende Problemlagen anzusehen und sie anzuerkennen, ohne zu bewerten oder bewertet zu werden. Echtheit, Empathie, positive Zuwendung und die Achtung vor dem Hilfesuchenden als Grundhaltung auf Seiten des Beratenden ermöglichen eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre und einen geschützten Raum zur Selbsterkundung. In solch einem Klima ist die Chance groß, dass Entwicklungspotenziale freigesetzt werden, die zu mehr Selbstakzeptanz, Flexibilität, neuen Perspektiven, mutiger Kreativität und neu erlebter Autonomie beitragen (Rogers, 2007).
Ein System ist eine Ganzheit. Jedes Teil ist mit jedem so verbunden, dass jede Änderung eine Änderung des Ganzen bewirkt…
Virginia Satir
Der systemische Therapie- und Beratungsansatz ist der umspannende Rahmen, in den ich meine Arbeit mit Einzelpersonen, Gruppen, Paaren oder Familien einbette. Die Einsicht, dass keiner von uns als isoliertes Individuum lebt, sondern wir uns immer in unterschiedlichen sozialen Kontexten bewegen und dadurch beeinflusst sind, legt die explizite Berücksichtigung dieser sozialen Eingebundenheit nahe. In einem System (Gruppe, Familie, Paar, Team, Nachbarschaft, Freundeskreis, Dorf, Stadt, Land, Kultur, etc.) ist das Fühlen, Denken und Handeln jedes Einzelnen durch die Interaktionen (verbal und nonverbal) mit den Personen aus dem jeweiligen Umfeld geprägt. Ursachen für Spannungen, Probleme, psychische Störungen oder Belastungsreaktionen werden in der systemischen Betrachtungsweise nicht dem Einzelnen zugeschrieben, sondern es wird angenommen, dass diese Bedingungen viel eher durch das System erzeugt und aufrechterhalten werden (Schlippe & Schweitzer, 2016). Symptome werden eher als Ergebnisse, Reaktionen, Bewältigungs- oder Lösungsstrategien des Einzelnen in dem betreffenden System interpretiert. Das bedeutet, dass Symptome in einem System gewissermaßen eine Funktion erfüllen können, die das System in seiner jetzigen Form aufrechterhält. Prof. Stürmer (2010) erklärt in diesem Zusammenhang sehr anschaulich, wie sich der systemische Gedanke in der akademischen Psychologie entwickelt hat:
„Gründerfiguren der Community Psychology (psychologische Teildisziplin, die sich mit dem Erleben und Handeln von Individuen in ihren Communities, sprich ihren räumlich wie sozial definierten Kontexten befasst) kritisierten die Vernachlässigung des sozialen Kontexts in der traditionellen Psychologie als psychologisch-reduktionistisch. In ihrer Vision der Community Psychology stellten sie daher die Analyse der Beziehung zwischen Individuen und ihren Communities (d.h. ihren Lebenskontexten) in den Mittelpunkt. Ein Ausgangspunkt dieser Kritik war die individualtherapeutische Ausrichtung der klinischen Psychologie, deren Interventionsmethoden typischerweise auf die Veränderung oder Korrektur individueller Erlebens- und Verhaltensweisen abzielten, während Veränderungen der sozial-kulturellen (oder im weiteren Sinne ökologischen) Bedingungen, die zur Verursachung oder Aufrechterhaltung des Verhaltens beitragen, nur selten Gegenstand traditionell etablierter Therapieansätze waren.
Während in weiten Teilen der Psychologie die Tendenz vorherrscht, Ursachen für individuelle und soziale Probleme im Individuum zu suchen – mentale Probleme werden durch negative kognitive Schemata (Beck, 1967) oder einen unvorteilhaften Attributionsstil erklärt (z.B. Abramson, Seligman, & Teasdale, 1978), Konflikte zwischen Gruppen durch individuelle Vorurteile von Personen (Allport, 1954) – bemühen sich Community Psychologen um ein systemisches Verständnis von Kausalität, das Einflussfaktoren auf unterschiedlichen Systemebenen und deren Wechselwirkungen berücksichtigt.
Ein wichtiges Korrelat der systemischen Betrachtungsweise besteht in der „Entlastung“ des Individuums: An psychologischen Erklärungsansätzen, speziell im Bereich der klinischen Psychologie, ist wiederholt kritisiert worden, dass sie dazu tendieren, die Leidtragenden selbst für ihre Notlage und deren Lösung verantwortlich zu machen (z.B. indem einer depressiven Person defizitäre Problemlösekompetenzen attestiert werden, die sie verändern muss), anstatt die verursachenden Faktoren auf höheren Einflussebenen zu suchen (dem Lebensumfeld der Person inkl. den sozio-ökonomischen Lebensverhältnissen). (Stürmer, 2010, SB S. 9 ff)
Zu wissen, dass Veränderung möglich ist, und der Wunsch, Veränderungen vorzunehmen, dies sind zwei große erste Schritte.
Virginia Satir
Ein weiterer Aspekt, der in der systemischen Therapie und Beratung von besonderer Bedeutung ist, ist die Tatsache, dass lebende Systeme einem fortwährenden Wandel unterliegen und sich in ständiger Veränderung befinden. Ein lebendes System (Menschen, Tiere, Natur) kann sich nicht nichtverändern! Nichts ist morgen noch so wie es heute ist. Darum stellt sich mit Recht die Frage, wie Menschen es dennoch schaffen, dass sich ein Problem über einen langen Zeitraum nicht verändern kann. Aus systemischer Sicht ist vor allem die Frage interessant, wie Menschen es schaffen, sich nicht zu verändern oder zumindest den Eindruck erwecken, sie veränderten sich nicht. Wenn keine Unterschiede im Zeitverlauf mehr wahrgenommen werden, wenn Ausnahmen oder kleine Erfolge übersehen werden, wenn die eigene Person nur noch aus Defiziten und negativen Eigenschaften besteht, wenn die Möglichkeit der Veränderung nur noch bei den machtvollen anderen gesehen wird und die Dinge als schicksalhaft und unbeeinflussbar verinnerlicht werden, dann schafft man eine stabile Problemvergangenheit, die es kaum erlaubt auf vorhandene Ressourcen, kreative Lösungsideen oder eine andere – lebenswertere – Zukunft zu blicken. Arist von Schlippe und Jochen Schweitzer (2016) merken hierzu sehr humorvoll an: „Es gehört eine gewisse Fähigkeit dazu, sich als „Probleminhaber“ rund um das eigene Problem ein chronisches Zeiterleben zu konstruieren – mit unendlicher Vergangenheit, einer Gegenwart im Schneckentempo und einer nicht vorhandenen Zukunft.“ (S. 169).
Die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer Behausung wohnt der Mensch.
Martin Heidegger
Eine hilfreiche Veränderung kann bereits an der Stelle beginnen, wo der Sprache mehr Achtsamkeit zukommt und so ein Bewusstsein dafür entstehen kann, wie die eigene Geschichte erzählt wird. Denn, wie die eigenen Gedanken, Gefühle, Erfahrungen, Verhaltensweisen oder Möglichkeiten in Worte gefasst werden hat eine Wirkung auf unser Erleben und Handeln – im positiven, wie auch im negativen Sinne. Manfred Prior (2018) schlägt in seinem kleinen Büchlein wunderbar einfache Sprach-Interventionen mit großer Wirkung vor. Einige davon möchte ich Ihnen an dieser Stelle vorstellen:
- Anstatt „das kann ich nicht, das wird sowieso nicht klappen…“, ist es hilfreicher zu sagen „in der Vergangenheit war das nicht möglich“ oder „bisher konnte ich das noch nicht“.
- Anstatt sich zu fragen „ob“ etwas möglich ist, was momentan noch unerreichbar scheint, ist es hilfreicher sich zu fragen „wie kann etwas gelingen?“, „was kann ich unternehmen, um ans gewünschte Ziel zu kommen?“ oder „welche Alternativen stehen mir zur Verfügung?“.
- Anstatt darüber nachzudenken und zu formulieren, wie etwas „nicht“ sein soll, ist es hilfreicher den gewünschten Ist-Zustand auszudrücken, indem man ausspricht, was man „stattdessen“ will.
- „Immer“ stimmt in der Regel nie! Bei Dingen, die uns negativ beeinträchtigen, neigen wir dazu, diese als allgegenwärtig wahrzunehmen und entsprechend zu verbalisieren. Dass etwas allerdings immer, ohne Ausnahme stattfindet, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Hilfreicher ist es dann, sich an Ausnahmen zu erinnern und sich zu fragen, „bisher ist das wohl oft vorgekommen…, was müsste denn unternommen werden, damit das seltener geschieht?“.
Das, was wir aus unserer Perspektive sehen und wahrnehmen – unsere eigene Wirklichkeit – ist oftmals nur ein kleiner Ausschnitt des gesamten Bildes. Denn „Das Ganze ist mehr – oder besser gesagt: etwas anderes – , als die Summe seiner Einzelteile.“ (diese Einsicht geht zum einen auf Aristoteles und zum anderen auf die Theorie der Gestaltpsychologie zurück). In den 1960er Jahren war es vor allem der Kommunikationswissenschaftler und Psychotherapeut Paul Watzlawick, der auf sehr humorvolle Weise zeigte, dass wir nie (oder zumindest nur selten) den ganzen Zusammenhang einer Situation kennen. Allzu häufig gehen wir davon aus, die „Wahrheit“ zu kennen und vergessen dabei, dass wir nicht mit allen Perspektiven einer „Wahrheit“ vertraut sind.
Bei gleicher Umgebung lebt doch jeder in einer anderen Welt.Arthur Schopenhauer