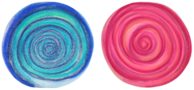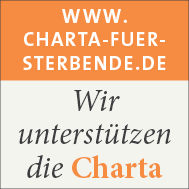Beschreibungen verändern das Beschriebene.
Arist von Schlippe
Beschreibungen greifen in das Beschriebene ein.
Worte sind nicht unschuldig, sondern Wörter sind unsere Wirklichkeit.
Psychologische Beratung, als professionelle Hilfeform, beschäftigt sich ganz allgemein betrachtet mit dem menschlichen Erleben und Verhalten. Systemische Therapie und Beratung stellt in der Regel aktuelle Beziehungsmuster im Hier und Jetzt in den Mittelpunkt der Betrachtung und fragt danach, wie sich Verhaltensweisen in einem System (Paar, Gruppe, Team, Familie, Organisation, etc.) gegenseitig beeinflussen und zur Stabilität von Problemen beitragen (Schwing & Fryszer, 2018). Ursachen für Probleme werden weniger als Defizite oder Eigenschaften eines Systemmitglieds verstanden, sondern viel eher als Wechselwirkung zwischen Problem/ Symptom und dem jeweiligen Kontext aufgefasst. Aus diesem Grund beschäftigen sich systemische Therapeut_innen und Berater_innen weniger mit der Vergangenheit und der Suche nach den klassischen Ursache-Wirkungszusammenhängen, sondern suchen nach neuen Informationen, die einen Unterschied machen, die alte Sichtweisen verstören, veränderte Sichtweisen ermöglichen und den Blick für neue Wege öffnen.

Der systemische Therapie- und Beratungsansatz baut auf den Grundannahmen der Systemtheorie (Kybernetik erster und zweiter Ordnung) und dem Konstruktivismus auf. Damit eröffnet er eine ganz neue Perspektive auf das menschliche Handeln unter Berücksichtigung des sozialen Kontexts. Der Konstruktivismus als erkenntnistheoretische Grundlage des systemischen Ansatzes bildet sozusagen den Gegenpol zum Realismus und geht davon aus, dass wir uns die Wirklichkeit durch unsere Gedanken und mentalen Aktivitäten selbst erschaffen (Willemse & von Ameln, 2018). Die beiden chilenischen Biologen und Erkenntnistheoretiker Humbero R. Maturana und Francisco J. Varela kamen durch ihre Forschungstätigkeiten zu der Auffassung, dass sich die Realität aus dem erkennenden Tun des Beobachters ergibt, der Unterscheidungen trifft und somit den Einheiten seiner Beobachtung Existenz verleiht (Maturana & Varela, 2015). Die zentralen Annahmen des systemischen Therapie- und Beratungsansatzes lauten (Willemse & von Ameln, 2018):
- Die Kommunikation und Interaktion in einem sozialen System (Paar, Freunde, Familie, Team, Organisation, ect.) ist durch eine Eigendynamik geprägt, die sich aus der jeweiligen Konstellation von Menschen und ihrem Erleben und Verhalten ergibt. Die Systemtheorie beschreibt dies als sich selbst organisierende Systeme.
- Die Wirklichkeit, so wie wir sie erleben und beschreiben, ist das Produkt unserer subjektiven Wahrnehmung und Interpretation – keine objektive Realität. Der Mensch wird als Schöpfer seiner eigenen Wirklichkeit betrachtet. Im Gegensatz zu einer realistischen Betrachtungsweise wird hier davon ausgegangen, dass Menschen (Individuen, Gruppen, Familien, Organisationen, etc.) ihre eigene Geschichte konstruieren, die aus ihrer Perpektive heraus stimmig und schlüssig (koheränt) erscheint. Dies ist jedoch immer nur die eine Wahrheit. Diese Geschichte kann aus einem anderen Blickwinkel betrachtet immer auch eine andere Wirklichkeit sein.
- Therapeut_innen oder Berater_innen werfen durch ihre Beobachtungsperspektive auf Klient_innen oder soziale Systeme ein neues Licht auf deren Wirklichkeit. Auch diese Sicht ist nur eine Möglichkeit von vielen und kann dabei helfen, eine hilfreichere Wirklichkeit zu erschaffen. Dies gelingt vor allem dann, wenn weniger nach Problemen, Schwieriegkeiten und Ursachen gesucht wird, sondern eine lösungsorientierte Herangehensweise gewählt wird.
- Der systemischen Ansatz betrachtet den Menschen nicht als isoliertes Wesen, sondern berücksichtigt immer auch den sozialen Kontext in den Klient_innen eingebettet sind. Der Fokus liegt damit weniger allein auf dem Individuum, sondern schließt soziale Bedingungsfaktoren konsequent mit ein und folgt einem Denken in Zusammenhängen. Auf diese Weise kann der Einfluss von Beziehungsmustern und Erwartungsstrukturen in angemessener Weise miteinbezogen werden.
- Damit ändert sich auch der Blick auf die Ursachen von Problemen. Traditionell wird danach gefragt, warum etwas so ist wie es ist und nach einer Kausalantwort „weil…“ gesucht. Bei komplexen Problemen stößt dieses linear-analytische Prinzip (Ursache-Wirkungs-Annahme) jedoch schnell an seine Grenzen und wird durch eine solche Vereinfachung menschlichem Erleben und Verhalten nicht gerecht. Im systemischen Denken wird eher eine zirkuläre Kausalität angenommen, wo sich Ursachen und Wirkungen gegenseitig bedingen. Solche Wirkungsketten gilt es aufzudecken und zu unterbrechen.
Die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen.
Viktor Frankl